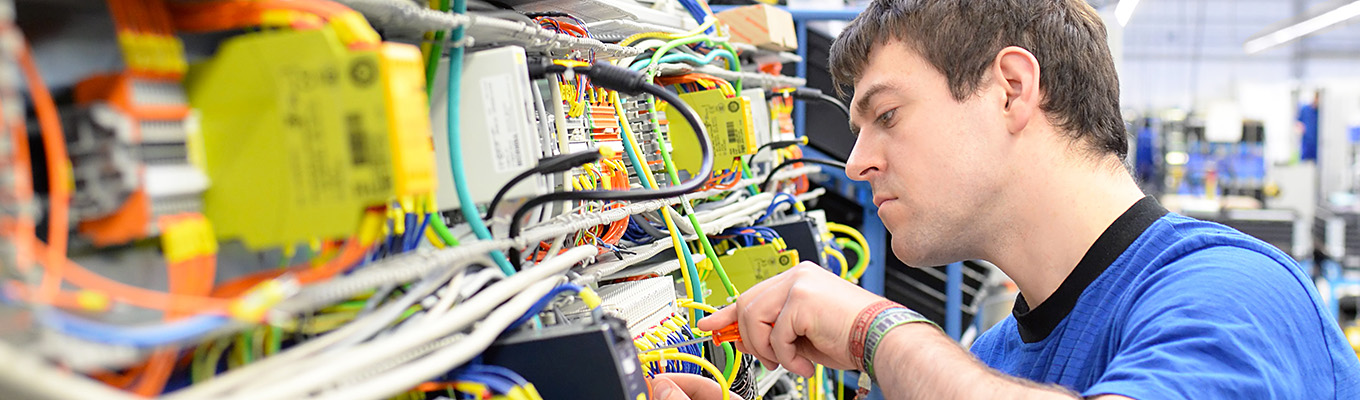
21. Mai 2025
Elektrofachkraft, Elektrotechnik, Arbeitssicherheit, Sicherheit
Neue Wege in der Elektrotechnik: Wer an elektrischen Anlagen arbeitet, braucht mehr als technisches Geschick
Kennen Sie die folgende Situation? In der Fertigungshalle eines mittelständischen Industriebetriebs steht eine neue Maschine – hochmodern, effizient, bereit für den Einsatz. Doch sie läuft nicht. Der Anschluss ans Stromnetz fehlt und die firmeneigene Elektrofachkraft ist gerade auf drei anderen Baustellen gleichzeitig gefragt. Der Produktionsleiter wirft einen Blick auf die Uhr, der Starttermin rückt näher. Die Monteure warten, die Bänder stehen still. Alles ist vorbereitet – nur die eine Hand fehlt, die das System in Gang bringt…
Es sind genau diese Situationen, die in vielen Betrieben dazu führen, dass Personen Elektroarbeiten übernehmen, ohne über die dafür nötige Qualifikation zu verfügen. Oft geschieht das in bester Absicht - schließlich drängt wie hier im Beispiel die Zeit und die Produktion soll weitergehen. Was vielen Beteiligten nicht bewusst ist: Bereits einfache Eingriffe in elektrische Anlagen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn sie nicht von entsprechend ausgebildeten Personen ausgeführt werden.
Dieser Blogbeitrag beleuchtet, welche Vorgaben für Elektroarbeiten gelten und welche Qualifizierungswege rechtssichere Alternativen bieten – auch ohne klassischen Elektroberuf.
Lesezeit: 5 Minuten
Im Bereich der Elektrotechnik kommt zu dieser Situation erschwerend auch noch der Mangel an ausgebildeten Elektrofachkräften hinzu. Für viele Betriebe ist es schmerzlich spürbar, dass Neueinstellungen schwierig bis nahezu unmöglich sind. Auch externe Unterstützung ist oft - wenn überhaupt - mit hohen finanziellen Aufwänden verbunden. Die Folge: Elektrotechnische Aufgaben werden informell verteilt – und damit häufig mit rechtlichem Risiko belastet ausgeführt.
Es sind genau diese Situationen, die in vielen Betrieben dazu führen, dass Personen Elektroarbeiten übernehmen, ohne über die dafür nötige Qualifikation zu verfügen. Oft geschieht das in bester Absicht - schließlich drängt wie hier im Beispiel die Zeit und die Produktion soll weitergehen. Was vielen Beteiligten nicht bewusst ist: Bereits einfache Eingriffe in elektrische Anlagen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn sie nicht von entsprechend ausgebildeten Personen ausgeführt werden.
Dieser Blogbeitrag beleuchtet, welche Vorgaben für Elektroarbeiten gelten und welche Qualifizierungswege rechtssichere Alternativen bieten – auch ohne klassischen Elektroberuf.
Lesezeit: 5 Minuten
AUF DEN PUNKT
|
Manchmal geht es schnell: Der Motor steht, die Produktion stockt – und alle schauen sich mit den sprichwörtlich großen Augen an: Keine Elektrofachkraft vor Ort, keine Reparatur und somit keine schnelle Lösung. Zum technischen Problem hinzu tritt das Fehlen von entsprechend qualifiziertem Personal.
Gerade im Bereich Elektrotechnik zeigt sich, wie wertvoll fachliche Ausbildung und verbindliche Prozesse sind. Besonders unter dem Gesichtspunkt des Fachkräftemangels stellt sich an dieser Stelle für Verantwortliche immer häufiger die Frage: Was tun, wenn elektrotechnische Aufgaben anfallen, aber die nötige Fachkunde fehlt?
Zwischen Alltag und Anspruch: Das Spannungsfeld in vielen Betrieben
In zahlreichen Unternehmen herrscht oft ein pragmatischer Umgang mit technischen Aufgaben: „Das kann doch der Kollege machen.“, „Der hat schon öfter an der Anlage gearbeitet.“, „So schlimm wird es nicht sein.“. Was nach Flexibilität klingt, birgt Risiken – für die Mitarbeitenden, für Anlagen, für die Geschäftsführung.Im Bereich der Elektrotechnik kommt zu dieser Situation erschwerend auch noch der Mangel an ausgebildeten Elektrofachkräften hinzu. Für viele Betriebe ist es schmerzlich spürbar, dass Neueinstellungen schwierig bis nahezu unmöglich sind. Auch externe Unterstützung ist oft - wenn überhaupt - mit hohen finanziellen Aufwänden verbunden. Die Folge: Elektrotechnische Aufgaben werden informell verteilt – und damit häufig mit rechtlichem Risiko belastet ausgeführt.
Rechtslage: Verantwortung bleibt, auch wenn Personal fehlt
Die Regelwerke – darunter Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Vorschrift 3, TRBS 1203 und DIN VDE 1000-10 – sind eindeutig und lassen keinen Interpretationsspielraum: Elektrische Anlagen dürfen nur von qualifizierten Personen errichtet, geändert, geprüft oder instandgehalten werden. Kommt es zu einem Unfall oder Schaden, stehen nicht nur die Ausführenden, sondern vor allem die Führungskräfte der Geschäftsleitung in der Verantwortung. Kurzum: Fehlende Fachkunde zieht ein Organisationsverschulden nach sich, was wiederum zu rechtlichen und versicherungstechnischen Konsequenzen führen kann.Lösungswege in Industrie und Handwerk
Fakt ist: In vielen Industrie- und Handwerksbetrieben fehlen ausgebildete Elektrofachkräfte. Trotzdem müssen regelmäßig Aufgaben erledigt werden wie:- Maschinen elektrisch freischalten,
- defekte Leuchten oder Sensoren austauschen,
- Leitungen prüfen oder Kleinreparaturen durchführen.
Ein Lösungsweg, um diese Situation zu entspannen, ist die gezielte Qualifikation - angepasst an den Arbeitsbereich. Zwei Wege stehen besonders im Fokus:
Voraussetzungen:
1. Elektrofachkraft für festgelegte, gleichartige, sich wiederholende Tätigkeiten (EFKffT) - „Wie ein Spezialwerkzeug – gemacht für eine einzige Aufgabe.“
Die EFKffT ist keine vollwertige Elektrofachkraft, sondern eine Person, die nach Schulung, Prüfung und entsprechender betrieblicher Einweisung in die spezielle Tätigkeit befähigt wird, definierte elektrotechnische Tätigkeiten durchzuführen.Voraussetzungen:
- Vorbildung in einem nicht-elektrotechnischen Beruf, z.B. Industriemechaniker, Anlagenbediener etc.
- Zusatzqualifikation durch Schulung in Theorie und Praxis inkl. Prüfung
- fachliche Einweisung in die spezifische festgelegte Tätigkeit vor Ort im Unternehmen
- Bestellung durch den Arbeitgeber für diese festgelegten Arbeiten
- regelmäßige Wissensauffrischung und Unterweisung
Zulässige Tätigkeiten:
- müssen festgelegt sein (z.B. „Austausch eines Sensors an Maschine X“)
- müssen gleichartig sein (immer wieder gleiches Vorgehen)
- müssen sich wiederholen (Routinearbeiten, kein Einzelfall)
Beispiele:
- Austausch von Leuchten oder Steckdosen in der Produktion
- Rücksetzen von Maschinen nach Fehlern
- Durchführung einfacher Messungen
Wichtig:
Die Tätigkeiten werden vom Unternehmen klar definiert und dokumentiert. Keine Ausweitung oder Improvisation erlaubt!
2. Elektrofachkraft in der Industrie - „Eine erweiterte Qualifikation – aber kein vollwertiger Elektriker.“
Die sogenannte „Elektrofachkraft in der Industrie“ ist ein Mittelweg zwischen EFKffT und vollwertiger Elektrofachkraft.Voraussetzungen:
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten gewerblich-technischen Metallberuf
- nachweislich erworbene fachspezifische Berufserfahrung
- anwendungsbereite gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
- fachspezifische Schulung, deutlich umfangreicher als bei der EFKffT (i. d. R. mehrere Wochen) zum Erwerb von Kenntnissen über elektrische Gefahren, Schutzmaßnahmen und Fehlererkennung usw.
- Abschluss der theoretischen sowie der praktischen Lernerfolgskontrolle
- ausreichende - individuell zu bestimmende - fachbezogene Einarbeitung im Unternehmen
- Bestellung durch den Arbeitgeber für bestimmte festgelegte elektrotechnische Tätigkeiten
- kann eigenverantwortlich bestimmte festgelegte elektrotechnische Tätigkeiten eigenverantwortlich ausführen
Beispiele:
- Anschluss neuer Komponenten an vorhandene Systeme
- Arbeiten an Maschinen im Rahmen der Instandhaltung
Grenzen der Tätigkeiten:
- keine komplexen Neuinstallationen
- keine Arbeiten an Anlagen über 1 kV
- kein Ersatz für eine Elektrofachkraft mit Berufsabschluss
Wichtig: Die Verantwortung liegt weiterhin bei der vorgesetzten Elektrofachkraft im Unternehmen bzw. beim Arbeitgeber.
Fazit: Der Strom kennt keine Kompromisse – das Gesetz auch nicht
Elektroarbeiten sind kein Experimentierfeld. Sie erfordern klare Rollen, dokumentierte Befähigungen und Bestellungen sowie regelmäßige (Nach-)Schulung. Wer in diesem Bereich „mal eben“ etwas macht, setzt Gesundheit, Betrieb und Freiheit aufs Spiel. Deshalb gilt:- Nur qualifiziert ist erlaubt.
- Dokumentation schützt vor Haftung.
- Weiterbildung ist der Schlüssel zur Rechtssicherheit.
Bleiben Sie wissbegierig!

